Heizungswasser nachfüllen: Das müssen Sie beachten
Heizungswasser muss aufbereitet werden
Gerade moderne Heizungsanlagen arbeiten nur dann dauerhaft zuverlässig, wenn das Heizungswasser bestimmte Anforderungen erfüllt. Welche das sind, listet VDI 2035 auf. Viele Hersteller erheben in den Bedienungsanleitungen ihrer Heizungen jedoch noch strengere Anforderungen. Indem er das Nachfüllwasser entsprechend aufbereitet, sorgt ein Fachhandwerker dafür, dass es die geforderte Beschaffenheit aufweist.
Nicht nur das Warmwassernetz, sondern auch die Heizungsanlage selbst muss nämlich vor dem Heizungswasser geschützt werden. Damit das Wasser die Anlage nicht schädigt, ist eine Aufbereitung durch den Fachmann unumgänglich. Diese Aufbereitung hängt von der Beschaffenheit des vor Ort verfügbaren Wassers und der verwendeten Heizungstechnik ab.
Warum die Aufbereitung notwendig ist
Dass Heizungswasser kein normales Wasser ist, wird spätestens dann klar, wenn Sie einmal selbst Ihre Heizkörper entlüftet haben. Drehen Sie das Ventil einen Augenblick zu spät zu, passiert es leicht, dass neben der Luft auch etwas von dem verschmutzten Heizungswasser entweicht. Verantwortlich für die Verunreinigung des Heizungswassers sind die folgenden Bestandteile:
- Schwebstoffe
- Schmutz
- Rostpartikel
- Schlamm
Diese Stoffe entstehen durch die Reaktion des Heizungswassers mit Anlagenteilen und können früher oder später zum Problem werden. Ein Überblick über die in Heizungsanlagen für den Privatgebrauch verwendeten Materialien zeigt die Vielfalt der möglichen Wechselwirkungen zwischen den Stoffen:
Wechselwirkungen zwischen den Stoffen im Heizungswasser
- Kupfer
- Aluminium
- Edelstahl
- Messing
- Eisenmetalle
- Kunststoffe
- Gummimaterialien
Diese Materialien reagieren zum Teil auch selbst miteinander, was die Auswahl des optimalen Heizungswassers nicht gerade erleichtert. Dennoch definiert VDI 2035 einige allgemeine Merkmale für Heizungswasser, allen voran den pH-Wert, die elektrische Leitfähigkeit und die Härte. Je nach Region variiert die Zusammensetzung des Wassers deutlich. Hartes Wasser enthält beispielsweise viel Calcium und Magnesium.
Diese Stoffe können schädliche Ablagerungen verursachen. Wenn Sie mit Gas oder Öl heizen, kann sich im Heizkessel Kesselstein bilden, der erst dessen Effizienz beeinträchtigt und bei entsprechender Schichtdicke abplatzen und bewegliche Teile wie Pumpen und Ventile verstopfen kann. Solche Ablagerungen beeinträchtigen den Wärmeaustausch und setzen nachhaltig die Energieeffizienz der Heizungsanlage herab. Auch Ihren Anspruch auf Gewährleistung gefährden Sie, wenn das Wasser vom Hersteller festgelegte Grenzwerte nicht einhält.
Daneben sorgt auch ein möglichst geringer Sauerstoffgehalt dafür, unerwünschte Abläufe im Heizkreislauf zu vermeiden. Bei der ersten Befüllung der Anlage gelangt neben dem Wasser nämlich auch Sauerstoff in das System. Der Sauerstoff wird über die Zeit durch Korrosion verbraucht. Füllen Sie Wasser nach, gelangt neuer Sauerstoff in das System und die Beschädigung von Anlagenteilen durch die Korrosion schreitet fort. Generell sollten Sie daher so selten wie möglich Heizungswasser nachfüllen lassen.
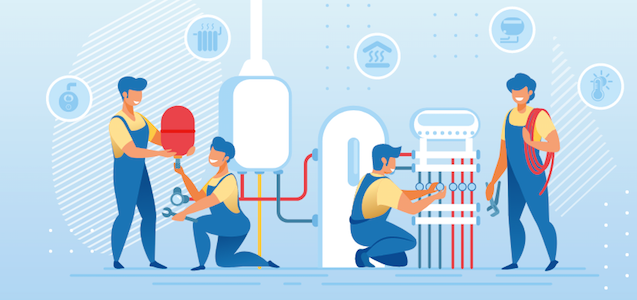
Verfahren zur Aufbereitung von Heizungswasser
Dem Handwerker stehen verschiedene Verfahren zur Aufbereitung des Wassers zur Verfügung. Dabei richten sich die Auswahl und der Umfang der Maßnahmen nach den Anforderungen der Heizungsanlage und der vorliegenden Wasserqualität.
Im einfachsten Fall enthärtet der Heizungsbauer das Wasser lediglich unter Zuhilfenahme eines tragbaren Gerätes. Darin findet ein chemischer Austausch statt, bei dem die Härtebildner im Wasser durch andere Teilchen ersetzt werden. Am Markt sind auch Enthärtungsanlagen für den dauerhaften Betrieb erhältlich. Diese werden in den Heizkreislauf eingebunden und verrichten dort ihre Arbeit. Die Frage, ob sich solch ein Gerät für Sie lohnt, kann Ihnen Ihr Installateur anhand der spezifischen Parameter Ihrer Anlage und der Anforderungen des Kesselherstellers beantworten.
Auch die Verfahren der Teil- und Vollentsalzung kommen zum Einsatz. So behandeltes Wasser weist nicht nur eine deutlich abgesenkte Härte, sondern auch eine geringe elektrische Leitfähigkeit auf. Den pH-Wert des Wassers, maßgeblich verantwortlich für die Korrosionstätigkeit, können Fachleute durch die Zugabe von Phosphat beeinflussen.
Beauftragen Sie einen Fachbetrieb
Sie sehen: Das Nachfüllen von Heizungswasser sollten Sie den Profis überlassen. Nur sie können im Zweifelsfall sicherstellen, dass das Heizungswasser fachgerecht aufgefüllt wird.
Außerdem kann der Heizungsbauer dank seiner Ausrüstung direkt vor Ort die Qualität Ihres Heizungswassers bestimmen und entsprechende Maßnahmen vorschlagen. Solch eine Analyse gehört zu einer gründlichen Wartung dazu. Ist die Anlage beispielsweise stark mit Schwebstoffen und Partikeln belastet, kann das Spülen der Heizungsanlage notwendig werden. Handeln Sie rechtzeitig, damit Sie Ihre Anlage vor Schäden durch Korrosion und Ablagerungen schützen können


Alle Rechte vorbehalten | Peter Knebel Haustechnik, Gronauer Str. 2, 61194 Niddatal

